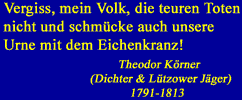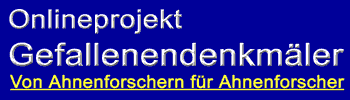Dürr-Arnsdorf,
ein Waldhufendorf, 245-313 m über NN, 1945 792 Einwohner, wird
erstmals urkundlich als Arnoldi Villa (Dorf des Arnold) erwähnt. In
einer Schrift vom 4.10.1620 beklagt sich die Gemeinde über die
Anordnung der „Fürsten und Stände“ betr. die sofortige Aushebung
jedes 19. Mannes, der „diechtig und wohl qualificieret zum
Kriegswehßen“ sein müsse. Vom 24.X.1648 wird berichtet, dass „Unterschietliche
truppen des Feindeß an den gebirgen marschirt und in Arnßdorff und
Kunzendorf sich logiret“. Am 9.XI.1648 heißt es: „Mit dem Regiment
Moncada gegen die Pollnische Neustadt gangen, und alß ich Von einer
schwethischen Parthey angegriffen worden, daß entlichen mich Von
ihnen ein gutter Stich salviret.“
Auf
Anregung des Dürr-Arnsdorfer Kriegervereins, unter dem Vorstand von
Karl Elsner, ließ die Gemeinde im Jahr 1929 zur Erinnerung an die
Gefallenen des Ersten Weltkrieges ein Kriegerdenkmal errichten. Das
Grundstück stellte Franz Görlich kostenlos zur Verfügung. Den
Entwurf für die Gedenkstätte fertigte das Hochbauamt in Neisse an.
Mit der Gesamtausführung war das Granitwerk Hugo Rother in Kaindorf
beauftragt. Als Material wurde heller Granit aus dem Kaindorfer
Steinbruch genommen. Das Denkmal ist zum Preis von 1480 Reichsmark
hergestellt worden. Finanziert wurde es zum Teil durch das Jagdgeld,
worauf die Verpächter zugunsten des Kriegerdenkmales für einige
Jahre verzichteten. Die Gestaltung und Ausführung der Arbeit an der
Vorderseite des Denkmals oblag dem Steinmetztechniker Hugo Rother,
jun. Am Fundament arbeiteten Paul Bittner (*18.1.1888), Sucha und
Karl Zacher (*21.8.1870). Die Steine für die Mauer und Abdeckplatten
stellten die Dürr-Arnsdorfer Steinmetze und Steinarbeiter Karl
Müller (*14.2.1898), Theodor Weidlich, Emil Seifert, Karl Görlich,
Josef Hamich (*3.3.1880), August Geier und die Brüder Franz,
Bernhard und Alfred Busch in kostenloser Arbeitsleistung her. Die
Kugeln bearbeitete Julius Böhm. Am Kernstück (0,90 x 0,74 x 2,51 m)
und dem Oberteil (Höhe 79 cm) arbeitete Josef Peter aus Kaindorf.
Das schmiedeeiserne Gitter fertigte Paul Blasig an. Die Weihe des
Denkmals nahm Pfarrer Heinrich Eckhardt am 15. September 1929 vor.
Bei der Weihe wurde das Lied „Den toten Helden“ gesungen:
Die
ihr Blut und Leib und Leben für uns habt dahingegeben – tote Brüder
ruht nun aus! Keines Schmerzes Weh und Schrecken, kann aus diesem
Schlaf euch wecken – ruhet aus, ihr seid zuhaus. Aber wir, die wir
hier oben noch im Sonnenlicht, geloben eins euch in die Gruft
hinein: Nicht umsonst habt ihr gelitten, nicht umsonst habt ihr
gestritten, eure Erben woll´n wir sein.
1945,
nach dem Krieg, wurden von Polen das 3,50 m hohe Denkmal umgestürzt,
Teile der Umfassungsmauer abgetragen und der 6,10 m breite
schmiedeeiserne Zaun entfernt. Die Wiederaufrichtung des Denkmals
erfolgte in einer sehr schwierigen Zeit durch die Initiative von
Karl Müller am 12. August 1992. Die fehlenden Granitsteine in der
Mauer und der Zaun wurden bis 1999 ersetzt. (Verfasser:
Karl Müller. 2010)